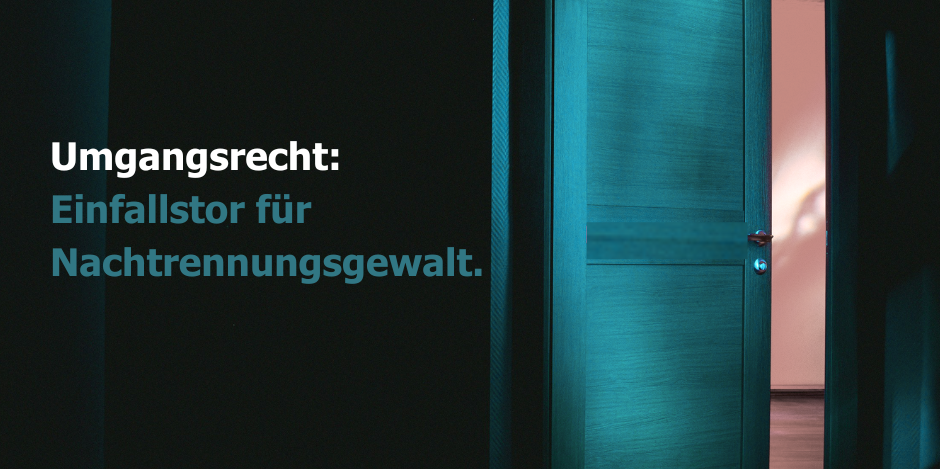Kaum Gewaltschutz im Umgangs- und Sorgerecht
Wenn Paare mit Kindern sich trennen, sich zur Umgangsregelung untereinander aber nicht einvernehmlich einigen können, werden Jugendämter und Familiengerichte hinzugezogen. Bei diesen Prozessen lassen sich patriarchale Strukturen erkennen, die gewaltbetroffene Frauen systematisch ausliefern und es erlauben, dass gewaltausübende Väter auf institutionellem Weg auch nach der Trennung Kontrolle über ihre Ex-Partnerin erlangen.
Jedes Jahr werden in Deutschland vor Familiengerichten im Kontext von Trennungen etwa 148.600 Fälle verhandelt (Hammer 2022)[1]. Dabei geht es vor allem darum, umgangs- oder sorgerechtliche Fragen zu entscheiden. Meist soll eine einvernehmliche Lösung zwischen Müttern und Vätern zum Umgang mit den gemeinsamen Kindern gefunden werden. Mütter und Väter, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt und die beide weiter einen festen Platz im Leben des Kindes möchten. Leider ist das jedoch nicht immer der Fall. Denn Trennungen können problematisch sein, in manchen Fällen sogar gefährlich. Vor allem für gewaltbetroffene Frauen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass das Gewalt- und Tötungsrisiko in der Trennungsphase für Frauen und Kinder um ein 5-faches höher ist (BMFSFJ 2011, S. 7)[2].
Häusliche Gewalt nach der Trennung
Bei jeder zehnten Trennung kommt es zu sogenannter Nachtrennungsgewalt, also Gewalt gegen die Frau und/oder das Kind durch den Ex-Partner. Frauen mit Kindern sind überdurchschnittlich stark betroffen: Laut einer Studie des BMFSFJ haben 70 Prozent der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren und deren Kinder Kontakt zum Vater haben bei Besuchen oder Übergaben erneut Misshandlungen erlebt. Bei den Kindern erlebten 58 Prozent während der Umgangszeiten mit dem nicht-sorgeberechtigten Elternteil Gewalt. Empirische Untersuchungen zeigen, dass gerade in der Trennungsphase das Gewalt- und Tötungsrisiko für Frauen und Kinder um ein 5-Faches höher ist (BMFSFJ 2011 S. 7)[2]. Hier zeigt sich, wie gefährdet gewaltbetroffene Mütter und ihre Kinder durch die Umgänge gewalttätiger Väter sind. Häufig, aber nicht immer, geht der Nachtrennungsgewalt eine gewaltvolle Beziehung voraus. Kam es bereits während der Beziehung zu häuslicher Gewalt, wird in 90 Prozent der Fälle Nachtrennungsgewalt ausgeübt (Barnett 2020, S. 20)[3].
In einer ersten bundesweiten Umfrage zum Thema „Nachtrennungsgewalt und institutionelle Gewalt bei Gewaltbetroffenheit in Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten“ geht TERRE DES FEMMES den Fragen nach Machtgefällen in Partnerschaften mit Kindern nach und den Auswirkungen dieser Machtgefälle auf Mütter und Kinder nach einer Trennung.
Quellen
[1] Hammer, Wolfgang (2022), „Familienrecht in Deutschland – Eine Bestandsaufnahme“, S.13.
[2] BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2011): FamFG. Arbeitshilfe zum neu gestalteten Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) bei Vorliegen häuslicher Gewalt. Verfügbar unter: www.bmfsfj.de/resource/blob/93728/ddf0bb44235e207056818876f794767f/famfg-familiensachen-arbeitshilfe-data.pdf [29.11.2024].
[3] Barnett, Adrienne. 2020: „Domestic abuse and private law children cases- A literature review”, Ministry of Justice Analytical Series